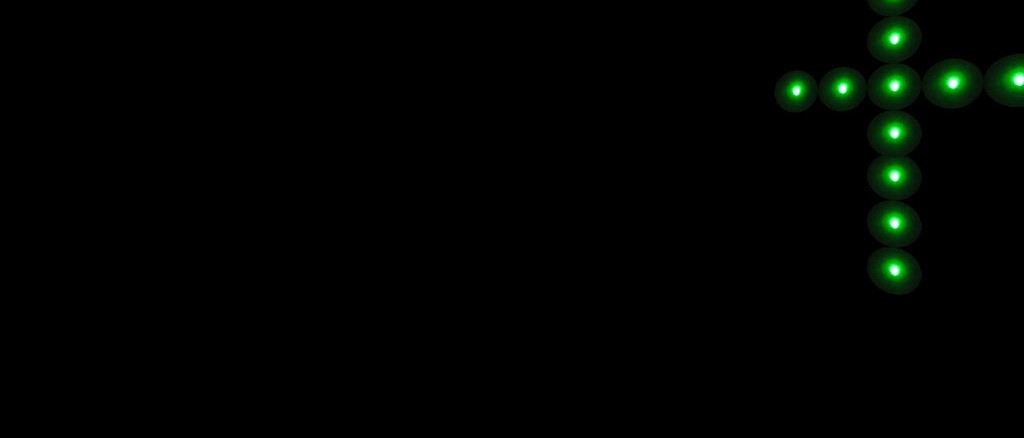
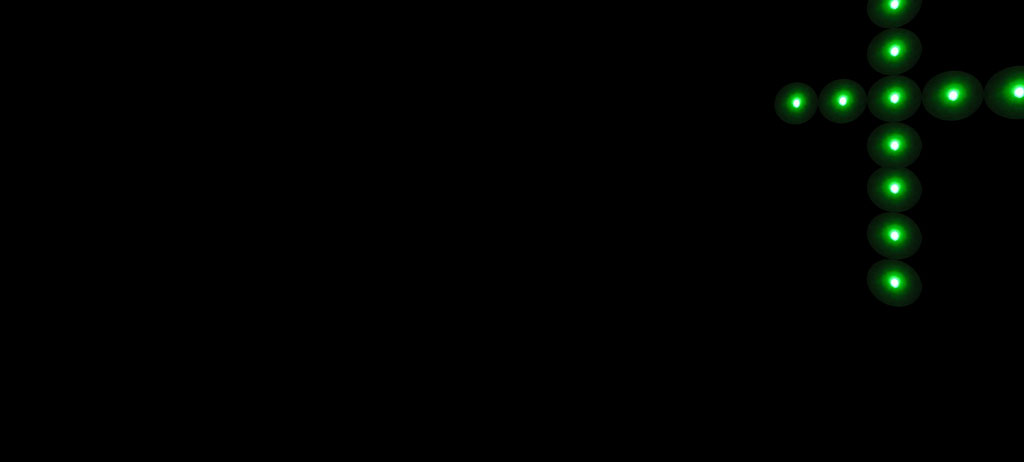
Hans Henny Jahnns Bühnenerstling “Pastor Ephraim Magnus” wurde von Frank Castorf am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg inszeniert. Für das HAMBURGER FEUILLETON war das ein Anlass, mit drei Rezensenten die Premiere zu besuchen – drei Texte aus drei unterschiedlichen Perspektiven sind in dem folgenden Rezensions-Dossier zusammengeflossen.
1915 — der große Krieg auf den Feldern Flanderns und Nordfrankreichs tobt schon ein dreiviertel Jahr. Die Fronten sind festgefahren und jeden Tag sterben auf beiden Seiten tausende junger Männer oder werden grausam verstümmelt, falls sie überleben. In der Hamburger Michaeliskirche hält Haupt-Pastor Hunzinger eine seiner beliebten Kriegspredigten, “Vorwärts gegen den Feind, zurück zu Gott” ist ihr Motto. Er fordert zum Durchhalten auf, alle noch so großen Opfer sind um Deutschlands Selbstbehauptung als christliches-lutherisches Land willen gerechtfertigt.
Das mag der 1894 in Hamburg-Stellingen geborene Hans Henny Jahnn nicht länger hören und schon gar nicht befolgen. Er emigriert mit seinem Freund Harms nach Norwegen, um der Einberufung zum Militär zu entgehen. Dort verfasste er sein erstes radikales expressionistisches Drama, das er Pastor Ephraim Magnus nennt.
Es wird 1919, Jahnn ist inzwischen nach Deutschland zurückgekehrt, gedruckt. Oskar Loerke erkennt Jahnn 1920 wegen dieses Stücks den renommierten Kleistpreis zu, was große Proteste hervorruft. Die Uraufführung des Dramas durch Bertolt Brecht und Arnold Bronnen 1923 in Berlin in einer radikal gekürzten Fassung ist ein Mißerfolg. Jetzt hatte dies schwer spielbare Stück am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg Premiere, Frank Castorf hat sich des Textes bemächtigt. (hjb)
Expressivität, Ekel
Man kann über Hans Henny Jahnn zutiefst unterschiedlicher Meinung sein. Für die einen ist der Hamburger ein expressiver Sprachkünstler, für die anderen ein schwurbelnd-dräuender Blut-und-Boden-Poet mit stark misogynen Zügen. Zum hundersten Geburtstag im Jahr 1994 gab es eine mehr oder wenig einhellige Würdigung von Greiner bis Flimm und eine grosse Volksausgabe, nur unwesentlich gestört von Regula Venskes fulminanter Antischrift »Weiberjahnn«, die wohltuend vielfältig die Brachialpoetik dieses Dichters auseinander nahm. Das Buch ist vergriffen, die Ambivalenz bleibt. (kms)
Denn unlesbar sei dieser ewig Hadernde, heisst es immer wieder, ein Grenzgänger, ein Universalgenie, gleich der Größe eines Thomas Manns. Nur eben einer, der sich sperrt, da seine Inhalte Grenzen ausloten, die schwer erträglich sind. Ein gegen Frauen Wütender, der empfiehlt, man müsse ihnen “einen Mast in den Schoß rennen … den Darm in den Schoß leiten”. Und tatsächlich, liest man ihn das erste Mal, wenn auch nur in Auszügen, stößt man an eine Wand aus Ekel. Es schüttelt einen bei so viel Wut gegen das weibliche Geschlecht. (nf)
Es geht in Jahnns Stück um die Ungeheuerlichkeit der Aufhebung der Trennung zwischen den Menschen, wie sie sich vor allem in ihrer nicht zugänglichen Körperlichkeit zeigt. Es geht dabei auch um die Obszönität, dass in Kriegen die Körper auf grausamste Weise zerrissen und geschlachtet werden, aber man dieses Thema der verletzten, sich verletzenden Körper sonst in der Öffentlichkeit, gar auf dem Theater nicht ansprechen darf.
Das ist natürlich ein dezidiert religiöses Thema, denn Religion entsteht aus dem Opfer der Körper, erst Menschen‑, dann Tieropfer, man opfert sie um die göttlichen Mächte zu besänftigen, die sich als Natur‑, Tier‑, oder Menschenschrecken zeigen. Noch die Hinrichtung Jesu Christi wird als Opfer gedeutet, aber als eines dass die Opfer ein für alle mal beenden soll. Und doch opfert der Mensch weiter seinesgleichen, im Krieg, durch Ausbeutung und Sklaverei. In einer Zeit explodierender Körper im Namen Gottes fragt sich Jahnn, was dürfen sich Menschen antun, um ihrem Geheimnis nahe zu kommen. (hjb)
Wenn man nun ein Mann wie Castorf ist, der von der ZEIT “Stückezertrümmerer” genannt wird und “Existenzialist” – wie geht so einer wohl damit um? Und was interessiert ihn an diesem Text? Die Göttlichkeit des Frevels? Die Blasphemie, Sodomie, Frauenfeindlichkeit, Lust an Gewalt über den Tod hinaus? Warum macht so einer einen Text, der ohnehin alles zertrümmert, was man menschlich, moralisch, wertschätzend nennen könnte? Was zertrümmert man an einem Text, der die Grundfeste unseres Daseins, all das, woran wir glauben (möchten), seziert und zerstückelt? Kann da nicht nur ein einziges Schlachtfeld übrigbleiben? Ich wäre zu gern dabei gewesen, als er mit Karin Beier besprochen hat, weshalb er diesen Text inszenieren möchte. (nf)
Immanente Theologie
Jahnn ist so verrückt, die bereits in den Evangelien ausgedrückte Hoffnung auf Überwindung einer die Menschen trennenden Körperlichkeit, theatralisch anzugehen — man denke an die hyperbelhafte Redeweise Jesu, “wenn dein rechtes Auge dich ärgert, so reiß es aus, es ist besser für dich, einst deiner Glieder verdirbt, als dass der ganze Leib in die Hölle geworfen wird.” (Matthäus 5,29f).
Das wird bei Jahnn ganz real genommen. Und zwar mit dem Fokus auf der Sexualität, die auch bei Jesus in der Rede vom Verschnittensein um des Himmelreichs willen eine Rolle spielt (Matthäus 19).
Jahnn steht in dieser Tradition, in dem er die sexuelle Körperlichkeit des Menschen wörtlich nimmt – “wenn ich dir, Mathilde ein Stück Fleisch (von mir) abschneide, so hast du dieses Fleisch auch noch zu lieben. Du hast vor meinen Gedärmen die gleichen Gefühle zu haben wie vor meinem Mund.”
Nur bekommt das bei Jahnn schnell etwas Frauenfeindliches, Frauenverachtendes. Die extrem verkörperlichte Sinnsuche richtet sich bei ihm gegen die Frau – der Mensch, der ausgehöhlt werden soll, um zu sehen, ob er eine Seele hat, ist die Frau. (hjb)
Bühne & Zweifel
Warum Castorf sich diesen Text vornimmt, bleibt bis zum Ende des über fünf Stunden dauernden Marathons am Schauspielhaus offen. Castorf traut dem Text keinen Meter über den Weg. Das beginnt damit, dass er den Abend als Soap in einem monströsen Bühnenbau inszeniert, der – sich immerfort drehend – Kirche, bürgerliches Wohnzimmer, martialische Folterkammer, Mausoleum und noch so viel mehr sein kann. (nf)
Man schaut auf einer der mehr oder weniger bekannten komprimierten Castorf-Bühnen, ein auf die Drehbühne montierte komprimierte Welt piranesischer Idee, so ineinander verschachtelt ist die Welt zwischen pastoraler Wohnstube, Orgel- und Streckbank, alles das das Mobiliar der Welt des bürgerlich-klerikalen Establishment. Die Insignien sind überdeutlich, die Bücherwand, das Kerzenmeer, die Orgel, Treppen, ein aufs Äusserste eingedampftes Abbild des Pfarrhauses. Überbordend im Dekor mit Klerik-Kitsch, über allem ein grünes Lichtkreuz, dass einer Las Vegas Wedding-Chapel gut zu Gesicht stünde. (kms)
Das Kulissenhafte, Überbordende dieser Mega-Bühne (Aleksandar Denić) wird durch das fortwährende Beisein eines Kamera- und Ton-Teams noch betont. Die meisten Szenen nehmen wir zwar live aber nicht direkt wahr, sondern über Leinwand. Wo in dem Mammut-Bühnenbild die Schauspieler sich gerade aufhalten, ist oft nicht mal mehr nachzuvollziehen. (nf)
Die Ästethik dieser Videos ist inzwschen entfernt von der dogma-artigen Wackelei früherer Jahre, stellenweise erinnert sie an die Werke des späten italienischen Neorealismo, opulent in ihrer verwaschenen Farbigkeit, perspektivisch durchdacht sind diese. Mitunter glaubt man im Kostümbild von Adriana Braga Peretzki den Pornchic eines Tinto Brass wieder zu erkennen, der lange Mantel über der blanken Brust des Vetters Paul (Carlo Ljubek) erinnert an ikonische Bilder des jungen Helmut Berger. (kms)
Die andauernde Präsenz der Kamerateams erschafft einen Verfremdungseffekt, der eine Annäherung an die Figuren trotz der riesigen Closeups, gar nicht erst zulässt. Man wähnt sich, entgegen aller ästethischen Rafinesse der Videoproduktion, wie in der schönsten Reality-TV-Show. Monstren des Alltags, vorgeführt auf den Mattscheiben des Theaters. (kms)
Das mag man – in Anbetracht dessen, dass einst kein Geringerer als Bertolt Brecht die Uraufführung des Stückes übernahm – als gekonntes Zitat deuten. Ebenso wie die Souffleuse, die den Schauspielern nicht von der Seite weicht und auch gerne mal angeschnippt wird, wenn der Jahnn-Text sich den Gedanken nicht fügen möchte. Anfangs ist es noch Stilmittel, das den theatralen Vorgang als solchen verstärkt. Am Ende scheinen die Schauspieler so gemartert von der düsteren Schlacht, die sie da schlagen, dass man sich vorstellen kann, wie gottfroh sie über diese Entscheidung Castorfs gewesen sein müssen. (nf)
Provokation oder Desinteresse? Die “Soap des Grauens”
Der Bühnen-Regisseur greift indes tief in das schon seit Jahrzehnten brüchige Regal der Tabuverletzung in der bürgerlichen Gesellschaft, der Reihe nach wird ein um die andere schale Grenzüberschreitung zelebriert. Die einstmals als sprachliche Exzesse gesehenen Texte Jahnns – in der Zeit des sterbendes Kaiserreichs expressiver Wahnwitz – werden durch ihre fortwährende szenische Illustration komlett dem Ennui preisgegeben.
Wir sehen nämlich das übliche Panoptikum aus Nacktheit, Körper- und sonstigen Flüssigkeiten, ein klein bißchen Folter hier, ein wenig angedeutete Selbstverstümmelung dort, kreischende Frauen, Lack, Leder, Exkremente gehören zum Repertoire. Nicht zu vergessen, die unvermeidliche Nazi-Nummer, ausgeführt in SS-Uniform mit kurzen Knabenhosen und drittklassig schnarrendem Schtonk-Idiom, was auch in der x‑ten Wiederholung niemals Chaplin wird, sondern ebenfalls unendlich langweilt. (kms)
Doch es sind nicht nur die Schauspieler, die durch das Schlachtgetümmel müssen. Auch das Publikum sieht sich einer Herausforderung gegenüber, der sicher ein Viertel am Premierenabend nicht standhält und das Stück in der Pause verlässt. Doch auch wenn es den Betrachter dabei öfter mal schütteln mag – die Herausforderung des Abends ist, dass Castorf den Text nicht ernst nimmt.
Die grundsätzliche Entscheidung, eine desavouierende Soap des Grauens zu inszenieren, trägt über fünf Stunden den Abend nicht. Schauspieler, die von der puren Wucht und Menge des Textes überfordert sind, die nur noch schreiend, hechelnd und keuchend Worte ohne Sinn hervorstoßen – das Ganze noch dadurch verstärkt, die Rolle der Johanna einer Schauspielerin zu übertragen, die keine Muttersprachlerin ist (Jeanne Balibar) – das entleert die Wortgewalt Jahnns zu sinnfreiem Gebrüll. (nf)
Deren Kollegen stehen vor lauter gewolltem Exzess gänzlich alleine da, ungeführt. Transportiert der Text einmal Inhalte, wie in einem der Theoreme zu Natur und Religion im zweiten Teil des Dramas, steht man an der Rampe und reibt mal wieder die Körper aneinander, vor lauter Erregung bleibt nichts mehr. Keine Gestaltung, keine Form – auch wenn jemand wie Castorf bekanntermassen eine Premiere nicht als Endprodukt begreifen mag, sondern als ständige Weiterentwicklung. Man fragt sich allerdings, wohin.
Folglich liegt die wahrhafte Provokation dieses Abends beileibe nicht im intendierten Tabubruch, all die exzessiven kleinen Sauereien sind nicht im geringsten erschreckend, diese Art der Aufregung lockt höchstens noch die lokale Boulevard-Berichterstattung aus dem Tiefschlaf (»Nazis, Folter, Sex im Schauspielhaus« – titelte die BILD am Tag danach). Wirkliches Entsetzen rufen das offensichtliche Desinteresse des Regisseurs an seinem Stoff wie auch an seiner Arbeit mit den Schauspielern hervor. (kms)
Der Abwesende
Dass Frank Castorf dann irgendwie doch noch Sozialist ist, entnehmen wir dem vielfarbigen Programmheft. Man liest dort Marx und Bataille und darauf bezugnehmendend einen Text des Meisters selbst. Denn natürlich ist in dieser Lesart Jahnns Werk kapitalismuskritisch, folglich geht es um den Wert des Menschen und der Arbeit in und an der Gesellschaft, so sagt der Regisseur.
Und jüngst tat er in einem Interview in der ZEIT kund, er misstraue “einem Demokratiebegriff, der aus dem angloamerikanisch-puritanisch-protestantischen Max-Weber-Raum kommt.” Das mit der Religion ist in diesem “Raum” selbstredend auch so ein Ding zur sozialen Unterdrückung, Opium fürs Volk. Man fragt sich unwillkürlich, ob ein Theatermacher des 21. Jahrhundert über diesen ideologischen Tellerrand nicht hinauszublicken vermag.
Doch der unlustige Regisseur Castorf hat die Rechnung sozusagen ohne den von ihm so verschmähten Wirt gemacht. Die Welt der von sich und der gesellschaftlichen Verpflichtung gepeinigten Kreaturen ist bei ihm naturgemäß hoffnungslos, durch und durch verderbt und nur vom Theorem eines neuen Theaters der Grausamkeit geprägt – von Artaud zu Jahnn ist es für ihn nur ein einfacher und dann auch kurz gedachter Schritt.
Plötzlich ist da diese kleine Bachmelodie, vor über 300 Jahren aufgenommen in das Büchlein, dass der fast vierzigjährige Johann Sebastian für seine Frau zusammengestellt hatte. »Bist du mir« singt die Schauspielerin Bettina Stucky, eine schlichtes Stück, nicht eigentlich von Bach, eine Adaption.
Es ist ein Hoffnungschoral, eingestreut in illustrierender Absicht, eigentlich nur, um klerikales Geraune, um Ambiente zu schaffen, wie alle Musik an diesem Abend. Der Autor war ja auch Orgelbauer, das Stück spielt im zweiten Teil in der Sakristei der Kirche, eine Orgel kommt vor. Alles irgendwie eins, Orgelmusik, Kirche, Drangsal, so ist die Welt dort oben auf dieser Bühne.
Aber das kleine Lied, gesetzt in der »warmen« Tonart Es-Dur, schlägt mit Gewalt zurück aus dem Trommelfeuer Jahnnscher Ergüsse von Verstümmelung und Gewalt, von Frauenverachtung und deren vorwiegend desinteressierten Umsetzung in dieser Regiearbeit. Was Castorf und die Seinen als echte Verächter jedweder Transzendenz offenbar nicht verstehen können, ist die tröstende Absicht solchen Liedguts.
Bist du bei mir, geh ich mit Freuden
zum Sterben und zu meiner Ruh.
Ach, wie vergnügt wär so mein Ende,
es drückten deine schönen Hände
mir die getreuen Augen zu
Der innige Text ist in all seiner barocken Hingabe ein Appell an die Zuversicht angesichts des unausweichlichen Todes, solange man nicht allein ist. Eine andere Farbe ist da für einen Moment vorhanden, gar Trost. Doch da kein Vertrauen herrschen darf an diesem Abend, sondern einzig banale Destruktion, bleibt der Moment eine Randnotiz, untergegangen in den Stahlgewittern der Verachtung eines Regisseurs. (kms)
“Er hat nicht geliebt. Das ist der Tod”, sagt Josef Ostendorf als Pastor Ephraim Magnus eingangs. Dem mag man aus tiefstem Herzen zustimmen. Ein Regisseur, der einen Text inszeniert, den er nicht ernst nimmt, lässt es lieber. (nf)
Anmerkung der Redaktion: Wir haben uns — nach Veröffentlichung des Artikels — entschieden, die Autoren der einzelnen Passagen durch ihr Kürzel kenntlich zu machen, damit die einzelnen Meinungen erkennbar werden: Hans-Jürgen Benedict (hjb), Natalie Fingerhut (nf) und Matthias Schumann (kms).



Ich frage nicht, wie man ein solches Stück schreiben kann-der Autor ist wohl mehrfach gestört. Ich frage aber, wie man es aufführen kann. Doch keiner der Teamwork-Rezensenten hat sich offenbar getraut, diese einfache Frage zu stellen und nachvollziehbar zu beantworten. Einer allein hätte sich vielleicht drangemacht, Zweifel klingen in diesem Meinungspotpourri ja manchmal durch. So wird an vielen Stellen sanft bis harsch kritisiert, die bei diesem Stück aber zweifellos veranlaßte Sinnfrage nicht gestellt.- Dies zur Sache, in der Form habe ich Zweifel, ob eine solche Gemeinschaftsrezension vertretbar ist. Bei Sachreportagen kann man nehrere Reprorter in einem Beitrag berichten lassen-aber bei Rezensionen? Da kommt’s doch sehr auf die ganz persönliche Meinung und die Verpflichtung an, Farbe zu bekennen, und das kann in einem Rezensions-Teamwork kaum gelingen. Und welcher Zensor, bitteschön, hat die verschiedenen Beiträge denn gekürzt und dann das Einheitswerk geschaffen? Hier paßt mal auf eine Rezension der alte Spruch in abgewandelter Version: Tinte trocken-alle Fragen offen…