
So kann es gehen. Da steht ein Schauspieler und spricht und redet Dinge, die wir in diesen Zeiten schwer verstehen müssen. Er redet von hohen Idealen und in einem Versmaß, das die meisten Menschen von heute nicht einmal mit dem Namen kennen, und spricht während fast vier Stunden einer Aufführung viel, sehr viel. Aber man liebt ihn und seine Sprache. Der Schauspieler heißt Jens Harzer und er hat einen wirklich großen Abend als Marquis Posa in Schillers “Don Karlos”. Der heißt an diesem Thalia-Abend “Don Carlos” und inszeniert hat ihn Jette Steckel, die sich noch gar nicht vor allzulanger Zeit in den komplizierten Netzen des “Woyzeck” so verstrickt hatte. An diesem Abend hat sie so ziemlich alles richtig gemacht, allem voran in der glückhaften Besetzung ihrer Protagonisten.
Dieser Posa spricht deutlich, scharf akzentuierend, scharf denkend – so nimmt man ihm wohl ab –, aber die Kunst des Jens Harzer liegt in der Brechung der achsoschweren Schillerschen Sprache. Kein jambisches Gereite, kein deklamatorisches Gestenze, nein, ein Stil, der eigen ist in seiner fremdartigen Diktion, in seiner natürlichen, fast naiven Sprechweise (man mag da schon an Schiller denken, vielleicht an Kleist in seiner “allmählichen Verfertigung”). Der Atem stimmt und der Fluss der Rede, geschmeidig gemacht durch die Alltäglichkeit der Ansprache, die plauderischen Zwischenlaute der Konversation. Der hohen Absicht wird ein schnelles “Ne?” nachgeschoben, geradlinig auf den Kern einer Aussage zugesteuert, eine Forderung wird real durch ihre Beiläufigkeit. Und nicht einmal die Alltäglichkeit wirkt dabei banal. Harzers Posa ist ein gutaussehender Mann, einer, der sich die Orden seiner militärischen Erfolge nur nach Bedarf und Zeremoniell an den blauen Zweireiher stecken muss, nicht etwa, um dadurch zu wirken. Nicht einmal der volkstümlich über dem Stück schwebende “Gedankenfreiheits”-Vers schafft es, sich in die Höhe der Zitierwürdigkeit zu schrauben. Da sitzt die Pause wie eine Pointe, das Publikum wartet auf das nachgeklappte “Sire” und es kommt nicht von vorne, es kommt aus dem Parkett, als sei die Unvollständigkeit des Bekannten nicht zu ertragen. Das ist beeindruckend.
An diesem Abend spielt der Namensgeber des Schillerschen Dramas keine wirkliche Rolle. Mirco Kreibisch macht seine Sache wirklich exzellent, aber dieser Don Karlos ist mit Fug und Recht als Pfeife zu bezeichnen. Die Weigerung seines Vaters, ihm die Macht zu übergeben, ist hart, aber für uns plausibel. Wirklich niemand im vollbesetzten Thalia würde diesem jungen Mann auch nur die Schlüssel seines Familienwagens anvertrauen. Der sitzt, hübsch gestaltet mit langem Mittelscheitel und Ringelhemd schon beim Einlass auf der Vorbühne und malt mit dickem Filzstift Parolen auf ein Protestplakat. Der für alles engagierte Attac-Aktivist mit krausen Gedanken und vielen Ideen mag da Pate gestanden haben, ein Macher ist dieser Typ gewiss nicht. Und niemand versteht so recht, was Elisabeth oder die Eboli an diesem laschen Typen begeistern kann. Die kommen allerdings auch nicht so recht aus den Startblöcken, eigentlich erstaunlich für die Inszenierung einer Regisseurin dieser Generation. Ein bisschen amüsant wird dann auch die Konfrontation zwischen der Gräfin Eboli und Don Karlos, deren Flamencogehabe gerade so an der unfreiwilligen Komik vorbeischliddert – ja, in Spanien ist das Teil der Volkskultur und in Spanien spielt das ja auch alles.

Überhaupt gibt es solche Grenzsituationen in einem eigentlich stimmig scheinenden Konzept gelegentlich, die zu einem “gerade nochmal gutgegangen” Seufzer verleiten können. Sicher, dazu gehört auch der Weltenmonolog Philipps, garniert mit einem Chaplin-Ballet mit einer offenbar aufgeblasenen, nicht sichtbaren Weltkugel. Aber der Mann, der das spielt, heißt Hans Kremer; vor Jahren, 1985, war er ein bonbonbunter Carlos am Rande der Lächerlichkeit in München unter Alexander Lang – hier bewahrt er die Würde eines großen Schauspielers. Fein ist der Gestus, enttäuscht die Haltung, konsequent sachlich sein Handeln. Er steht Harzers Posa, dem scharfen Idealisten, als ein Manager in einer schwarzledernen USM-Haller-Welt, dessen Nachfolgeproblem offensichtlich ist, gegenüber. In dieser Szene heißt das ja wohl “auf Augenhöhe”. Steckel hat sich sein Fontainebleau von ihrem Bühnenbildner Florian Lösche als ein wunderliches Getriebe aus 80 mit schwarzem (Kunst-)Leder bespannten rechteckigen Elementen bauen lassen, die einen trapezförmigen Horizont bilden. Die Ringdrehbühne des Thalia ermöglicht eine schnelle, oft tänzerisch anmutende Verwandlung der Räume, die Elemente wirbeln umeinander, fest ist da nichts im königlichen Schlosse, ein Quirl der Beziehungen ist dieser Wald aus Wänden. Zwischendrin sieht man das Maßwerk der Rückkonstruktion dieser Wände, da wird es dann eng und piranesisch in den Räumen.
Der “Karlos” steht in seiner Aufführungsgeschichte für viel Politik, für idealistischen Szenenapplaus in unguten Zeiten. Dieser hier ist unpolitisch bis zur Schmerzgrenze. Was da wirklich interessant zu sein scheint, ist die Beziehung der Personen zueinander, die Dreiecksbeziehung zwischen Vater, Sohn und Posa, die Auseinandersetzung auf der gesellschaftlichen Ebene ist Machtkampf zwischen den Protagonisten, kein Kampf der Systeme oder gar Gedanken. Das funktioniert in der Tiefe hervorragend und ist schon etwas größere Theater-Kunst, an der Oberfläche gibt es dann aber doch gelegentlich einmal Entgleisungen.
Tatsächlich muss sich das so gelungene “Privatstück” die eine oder andere Frage gefallen lassen, etwa genau nach diesem Defizit einer politischen Haltung. Daran ändert auch das vorangestellte und auf den eisernen Vorhang projizierte seitenlange krude Manifest eines Julian Assange nichts, das die Sache wohl in die Welt von Globalisierung, Web 2.0 und ähnlichem zur Zeit durch die Medien getriebenen Zeugs bugsieren soll. Erschließen tut sich das nicht, es ist aber auch vollkommen egal, da die Binnenebene so sehr und anrührend gelungen ist.
Nachzufragen ist auch der intensive Einsatz von Projektionstechniken. Die schwarzen Hintergründe eignen sich gut für so etwas, allein, was erzählt es? Wozu die Entkörperlichung durch Closeup-Einspieler? Näher an die Personen kommt man damit nicht, im Gegenteil, der Verlust an räumlicher Tiefe und Entfernung schafft eher Distanz, da sieht es schwer nach Modernismus aus. Hin und wieder gelingen für den Moment schöne Eindrücke, Philipps Traum, mit der Einspielung eines krabbelnden Säuglings schafft einen schlüssigen Assoziationsraum, doch dieser Eindruck ist flüchtig, wiederum flächig und schwappt über in filmisch-ästhetische Gefälligkeit. Und das ist genau dann schade, wenn die präzise Personenführung dieser doch sehr talentierten Regisseurin hinter solchen Mätzchen verschwindet, weil alle auf die “Glotze” starren, die über der Szene schwebt. Das mit dem Film, insbesondere das New American Cinema, ist wohl auch ein Thema für sie. Der Schluss ist die theatrale Umsetzung eine Tarantino-Szene, Karlos und Elisabeth sterben unter pop-musikalischen Inserts (Acapulco? Las Vegas …) im Kugelhagel, blutdurchtränkt ihre Zivilkleidung. Auch das ist fragwürdig in der Umsetzung und fragwürdig ist auch die schon vergessen geglaubte Attitüde, filmische und theatrale Ästhetiken zu vermengen. Das hat nie funktioniert und hier tut es das auch nicht. Es bleibt – trotz alledem und alledem – ein guter Abend.

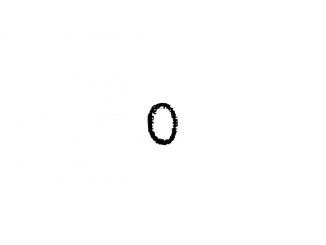
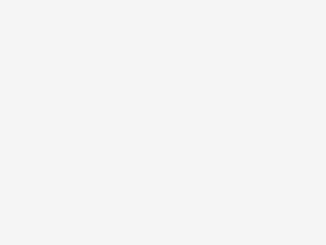
Hinterlasse jetzt einen Kommentar