Bekloppte.
Irre.
Verrückte.
Deppen.
Trottel.
Wahnsinnige.
Krüppel.
Doofe.
Idioten.
Schafköpfe.
Unfähige. [space size=20]
Es gibt doch recht viele Worte für das Fremde im Menschen. Es sind Distanzierungen, Abgrenzungen und Stimmen der Angst vor dem Anderen, dem Unvernünftigen, dem aus einer Norm gerückten, dem Ver-rückten. Und erzählt einem einer, es sei doch »total selbstverständlich«, nicht mit anderen Augen auf das Verhalten außerhalb dieser Norm zu schauen, so beeilt der bewusste Mensch sich, sein Einverständnis zu signalisieren.
Man könne doch nicht … die armen Behinderten … was die alles DOCH noch können … ist doch ergreifend … vom Schicksal geschlagen … und doch … – geschaut wird trotzdem. Und da auf dem Theater viel geschaut wird und viel ausgestellt, liegt es doch nahe, das auch einmal zu versuchen. Schon um darauf – worauf eigentlich genau? – hinzuweisen, wie ausgegrenzt all die sind, die nicht sind wie die Anderen.
Disabled Theater. Auf der Kampnagel-Bühne sind elf Menschen, die nicht sind wie die Anderen, und sie werden angeschaut. Einer nach dem Anderen. Am Rande des leeren Raumes, 11 Stühle im großen Viertelkreis, an jedem Stuhlbein eine Wasserflasche mit einem ordentlichen Mineralwasser, sitzt Simone Truong. Sie ist Choreographin, bedient einen Laptop und ruft die Akteure einzeln auf, zweisprachig, englisch und schweizerdeutsch. Jérôme Bel hat einen straffen Rahmen geschaffen für sein Projekt, sie ist die Zeremonienmeisterin für den Ablauf des Abends. Die Diktion ist schneidend und hat stark appellativen Charakter. »Jérôme Bel will …«, »Jérôme Bel möchte…« – Jérôme Bel stellt durch sie Aufgaben, eine nach der anderen.
Die erste dieser Aufgaben ist es, sich eine Minute lang dem Publikum auszusetzen. Gang an die Rampe, 1 Minute verharren, Abgang. Die Erwartung scheint hoch zu sein, es sind doch »Behinderte« – schaffen die das überhaupt? Keiner wird enttäuscht, denn natürlich ist die Minute bei den elf Darstellern unterschiedlich lang, von wenigen Sekunden bis hin zur Abgangsaufforderung vom Inspizientenpult: »Peter!« Es ist eine Übung.
Schon hier wird das Dilemma dieses Projekts deutlich. Natürlich stellt es »die armen Bekloppten« aus. Natürlich schaut niemand aus dem Publikum gerne hin. Und selbstverständlich ist diese knappe erste Viertelstunde quälend. Es bedeutet ja auch nichts, in erster Linie. Aber es wird auf die immer absurde, verdrehte Situation, auf den entblössenden Charakter des Theaters verwiesen, und angestarrt zu werden ist vermutlich nichts Neues für die Elf auf der Bühne. Aber trotzdem wird präsentiert, wird ausgestellt, wird vorgeführt.
Das geht auch so weiter, das Ensemble soll sich vorstellen, ein jeder seine »Diagnose« erzählen. Das reicht von Lernschwäche bis Trisomie, die Berufsbezeichnung ist bei allen »Schauspieler«. Schließlich hat jeder die Aufgabe – siehe oben – bekommen, nach einem Musikstück seiner Wahl eine eigene Choreographie vorzustellen. Das ist der Hauptakt des Abends, Jérôme Bel hat sieben Stücke ausgesucht, die der Reihe nach performt werden, unterdessen die Kollegen im Stuhlkreis teils kommentierend zuschauen. Ein jeder zeigt das, was er kann, und das, was er mag.
Der Zuschauer ist angemessen beeindruckt. Immer wieder greift die Bel´sche Klammer der Konfrontation zwischen dem Gewöhnlichen und dem Ungewohnten. Es ist kein erbauendes Vergnügen, deformierte Körper über die Bühne zappeln zu sehen. Es ist kein theatrales Können, kein Handwerk, nicht schön anzusehen.
Der teilweise stürmische Szenenapplaus würdigt immer den »Rahmen der Möglichkeiten« und nie einen direkten Akt der Erkenntnis. Und genau an dieser Stelle findet die Drehung des Verhältnisses zwischen den wohlwollend Begafften und den Gaffern statt. Aus dem Theatergänger wird ein Mitleidsapplaudeur. Das ist eine harte Erfahrung. Sie ist ohne Zweifel quälend. Das Theater fasst an und stellt bloß, Darsteller wie Zuschauer.
Denn die Fallhöhe ist hoch. Einerseits die Ausstellung des Theatermoments, eine kleine Entblößung des nach dem Effekt gierenden Zusehers. Und andererseits findet jene Bloßstellung, die das Ganze zeigen will, als Präsentation des Handicaps, der Unfähigkeit statt.
Es gibt eine alte romantische Sehnsucht in der Kunst nach der unmittelbaren, der ganz und gar reinen Erfahrung. Die Darstellung des luciden, genialischen Künstlers, der sich außerhalb gesellschaftlicher Normen befindet, führt hinein in eine Welt der Verklärung und Überhöhung von sozialen Defiziten, ist eine Rechtfertigung des unheimlichen kreativen Prozesses, dessen Herkunft nicht erklärbar scheint. Kreativität erscheint folgerichtig aus dem Wahn, herausgerückt aus der Mitte der Akzeptanz. Verrückt.
Faszinierend ist das für den »Normalen« unbegreifliche und nicht Fassbare, Genie und »Irrsinn« gehen in ihren Bedeutungsräumen Hand in Hand. Auch Jérôme Bel fühlt sich auf diese Weise inspiriert von seinen Schauspielern, er wünscht sich: »Zu zeigen, dass [ihre] theatrale Einzigartigkeit voller Versprechungen für das Theater und den Tanz ist, so wie ihr Menschsein es für die Gesellschaft im Allgemeinen sein sollte.«
Die Frage, ob das humane Anliegen des Theatermachers überhaupt durchdringt, ist an diesem Abend immanent. Schließlich, am Ende des Stückes, kommen die Darsteller noch einmal zu Wort, diesmal sollen sie ihre Erfahrung mit der Aufführung berichten. Einer sagt sinngemäß: »Meine Eltern fanden, das sei eine Freakshow, ich fand das nicht.« Beides ist wahr.
»Alles, was handelt, ist eine Grausamkeit.« Das steht bei einem anderen Ver-rückten, dem Theatervisionär Antonin Artaud.

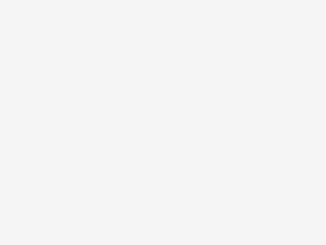


Hinterlasse jetzt einen Kommentar