Vier Backfische in Schuluniform am Bühnenrand vor dem eisernen Vorhang. Es ist dunkel, es wird gegiggelt und gequietscht, die Stimmung ist vergnügt, an der Grenze zur Teenager-Hysterie. Kreischender Abschluss der Szene ist ein Sprung ins kühle Nass, zumindest hören wir es platschen. Der Vorhang hebt sich, der Blick ist frei auf die monumentale Bühne von Florian Lösche. Variable Wandelemente, bedruckt mit abstrakten verpixelten Bildern, die sich mithilfe der Drehbühne blitzschnell zu immer neuen Räumen und Gängen schieben lassen. Die Verpixelung gibt allem, was darauf projiziert wird, einen leicht unscharfen Retrocharakter – ein kluger Zug, spielt sich der Roman Haratischwilis doch in der Erinnerung der Protagonistinnen ab.
Nun aber sind wir im Jahr 2019 in Brüssel, auf der Retrospektive einer der vier Hauptfiguren, als der Vorhang sich hebt. Dina Pirvelli hat es zu einiger Berühmtheit als Fotografin gebracht. Ihre drei Freundinnen Qeto, Nene und Ira treffen sich dort und erkennen mit Unwohlsein ihre traurige Berühmtheit durch die Bilder: »Hier stehen wir, das Trio, das entkommen ist, das den Sprung in die Gegenwart geschafft hat. Wir, die Überlebenden, die versuchen, für all diejenigen weiterzuleben, denen es nicht vergönnt war, und die für immer und ewig auf diesen Bildern jung bleiben werden«, sagt Qeto. Und schon ziehen Dinas Bilder die drei in den Bann der Erinnerung, nach Tiflis ins Jahr 1989 – und uns gleich mit.

Bild: Armin Smailovic
Die Zeit, die noch bleibt
Wir tauchen ein: In eine wilde Teenagerzeit, eine Zeit der großen ersten Lieben, der Unbedingtheit von Gefühlen, der Auflehnung gegen die eigene Familie, des wilden Rock’n‘Rolls, der Bruce-Lee-Plakate in Jungszimmern, auf deren Bettkanten das erste Mal scheu und unbeholfen geküsst wird. Wir erleben Familien und ihre (tragischen) Geschichten, das Unverständnis der heranwachsenden Generation über Entscheidungen ihrer Eltern, das Brüllen am Abendbrottisch, Heizungsausfälle und Tränenausbrüche. Das Aufeinanderprallen der Generationen, an das wir uns selbst noch erinnern, manchmal, wenn wir die Überlegenheit des Erwachsenseins vergessen, wird hier potenziert durch Mangelwirtschaft, Hunger, Armut, durch Familienmitglieder, die gestorben oder inhaftiert sind. Es ist ein Kessel voller Druck, der irgendwann zwangsläufig explodieren muss.
Film ab für ein Land am Abgrund
»Das mangelnde Licht« ist ein bildgewaltiger Strudel der Geschichte eines geknechteten Landes und der Menschen, die darin leben, temporeich und filmisch erzählt, teilweise in harten Schnitten, ein Strudel, bei dem man gerade erst in einer Szene angekommen ist, wenn die nächste beginnt. Es gibt Momente, da wünscht man sich, Regisseurin Jette Steckel hätte sich für manches mehr Zeit genommen, dafür auf den ein oder anderen Strang verzichtet. Ihre Stückfassung feierte einen Tag nach Erscheinen des Romas 2022 Première, Autorin und Regisseurin kennen sich aus Studientagen. Vielleicht ist das der Grund für Steckels vorsichtigen Umgang mit der Vorlage, die sie offenbar in jeder schillernden Facette auf die Bühne bringen wollte. Das macht den Abend partiell etwas atemlos. Aber hier soll weniger gemeckert werden: Die Bühnenfassung der 832 Buchseiten ist ein temporeicher filmischer Parforceritt durchs Buch in Bildern, die sich in die Iris brennen, und das spielversessene Ensemble stürzt sich mit einer Verve und Spiellust in seine diversen Rollen, dass es eine wahre Freude ist.

Das Georgien der 90er-Jahre ist durch politische Wirrungen, Mangelwirtschaft und Drogenhandel ein Land wie eine klaffende Wunde. Die vier Freundinnen straucheln durch die ersten Jahre der georgischen Unabhängigkeit, ein Land in Chaos und Gewalt, die Gespaltenheit einer jungen Demokratie, den Krieg in der Region Abrasien. Bürgerkrieg und mafiöse Strukturen nehmen im Lauf des Abends immer größeren Raum des Bühnengeschehens ein. Steckel inszeniert diese Situationen schonungslos brutal mit dem kalten Blick der Beobachterin von außen – dem Blick Dinas, die später als Kriegsreporterin durch Krisenregionen reisen und für ihre Arbeiten Preise gewinnen wird. Manche Szenen des Abends sind Ausnahmesituationen, in denen das moralisch-ethische Handeln der Freundinnen auf eine harte Probe gestellt wird.

Qetos Bruder Rati beispielsweise, ein wütender junger Mann voller Verzweiflung, wird immer tiefer in die Clan-Strukturen gezogen, obwohl er eigentlich gegen die die politischen Probleme seines Landes revoltieren möchte. Natürlich werden ihm Drogen untergeschoben, er wird inhaftiert. Eine große Geldsumme soll ihn aus dem Gefängnis holen. Mit ebendieser Summe laufen seine Schwester Qeto und seine Freundin Dina nachts durch das kriminelle Geschehen der Stadt. Sie passieren eine Schlägerei, in der zwei Clanmitglieder die Schulden aus einem Dritten herausprügeln. Dina entscheidet, den Prügelnden das Geld zu überlassen, um dem Mann das Leben zu retten. Sie wird später ihren Körper verkaufen, um Rati aus dem Gefängnis zu retten. Ein Bild in Dinas Ausstellung zeigt Qeto in genau dieser Situation. Es ist ein Moment moralischer Überlegenheit und uferloser Verzweiflung zugleich, vor Angst hat sie sich erbrochen. Ihr Blick matt vor Wut und Erschöpfung, ungläubig darüber, wie Dina in solch einem Moment den Auslöser der Kamera bedienen kann. Mit ebendiesem Foto wird Dina später Preise gewinnen.

Trügerische Flucht aus dem Moloch
Dies ist nur eine der Szenen, die sich an diesem Abend einbrennen. Wir begleiten die Hauptfiguren und ihre Familien, sehen patriarchale Familienstrukturen, junge Frauen, die in einer arrangierten Ehe ins Unglück stürzen, junge Männer, die in Clanstrukturen zerbrechen, das Heroin als einzige Möglichkeit zur Flucht aus dem Moloch. Wir sehen Traumata, die nicht mehr heilen werden, die Komplexität von Beziehungen, die Höhepunkte großer Gefühle und den Schmerz einer nicht erwiderten Liebe. Und nebenbei zeigen uns Bilder von Georgiens Bürgerkriegen eindrücklich, wie ein Land in politischen Machtkämpfen zerrieben wird. Am Ende schaffen es Qeto, Nene und Ira nach Brüssel – drei von Vieren. Sie haben überlebt. Manche haben eben mehr Recht auf Licht als andere. »Das mangelnde Licht« ist ein Rausch, der einen auf eine Art emotional verkatert zurücklässt. Wer sich darauf einlässt, wird danach atem- und vielleicht wortlos aus den Türen des Thalia Theaters treten in die frühlingshafte Nacht und den Nachhall noch lange spüren.
Zum letzten Mal in dieser Spielzeit am 14. April 2024 um 15.00 Uhr.

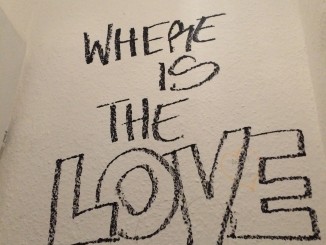

Hinterlasse jetzt einen Kommentar