
Jetzt aber dalli, Jungs! Denn die Russen sind im Anmarsch. Lauern in ihren Geländewagen irgendwo an einer Serpentinenstraße zwischen Bayern und dem Salzburger Land, weil sie auch scharf sind auf den Schatz. Irgendwo in einer Mine lagern nämlich saumäßig wertvolle Kunstwerke, geklaut von den bösen Nazis, darunter sogar eine bedauernswerte Madonna mit dem Jesusknäblein. Wehe, die fällt der Roten Armee in die Hände, man weiß ja nie, was solche Barbaren damit anrichten. Also schnell einen Sprengsatz legen und, heissa, die amerikanische Fahne zum Aufhängen am Mineneingang vorbereiten, damit die Iwans gleich sehen, wer die dicksten Eier in der Hose hat. Und nichts wie weg.
Klingt nach einer spätpubertären Schnitzeljagd? Korrekt. In seinem neuen Film »The Monuments Men« widmet sich George Clooney als Regisseur, Produzent und Hauptdarsteller einem bemerkenswerten Nebenschauplatz des zweiten Weltkrieges. Tatsächlich gab es in den letzten Kriegsjahren einen Trupp von US-amerikanischen Museumsdirektoren, Architekten und Historikern, deren Aufgabe es war, in Deutschland und im besetzten Frankreich geraubte Bilder und Skulpturen aufzuspüren und Kulturdenkmäler zu schützen.
Der Krieg und die Kunst. Ein wenig bekannter Nebenstrang der Geschichte, der in Deutschland in den letzten Monaten eine besondere Aufmerksamkeit bekommen hat: Etwas besseres als der Skandal um Cornelius Gurlitts fragwürdige Münchner Sammlung hätte George Clooney für seinen Film gar nicht passieren können. Und eigentlich sollte man meinen, dass Clooney auch der richtige Mann sein könnte für ein solches Projekt. Schließlich wird sein Name gern als Synonym für smarte und kritische Filme jenseits des Mainstream-Kinos genannt, ob es um den Politikbetrieb geht (»Die Iden des März«) oder um die unheilvollen Verflechtung von wirtschaftlichen Interessen und Krieg (»Syriana«).
Aber George Clooney kann eben auch Popcornkino. Und ausgerechnet die »Monuments Men« inszeniert er, als wär’s der fünfte Teil der Gaunerkomödie »Ocean’s Eleven«. Las Vegas oder Obersalzberg, das Rezept ist dasselbe: eine seltsame Gurkentruppe schräger Charaktere, die mit viel Köpfchen und Esprit einen Schatz erobern.
Dabei ist ebendiese Gurkentruppe absolut hochkarätig besetzt: ein Kriegsfilm mit Stars. Hollywoods schlagkräftigste Eliteeinheit, inklusive Charakterköpfen wie John Goodman und Bill Murray. Lebensvolle Gesichter, die eine Leinwand ausfüllen können, gerade, wenn sie gar nichts tun als schauen. Man muss zugestehen: das Ensemble funktioniert reibungslos, die Handlung spult sich ab wie am Schnürchen, nichts wird langweilig oder gar kompliziert.
Aber genau das ist auch das große Manko: Ein Kriegsfilm, der nicht einen Moment lang da hin geht, wo’s wehtut, eine Art »Top Gun«-Remake mit pseudo-intellektuellem Anspruch. Ein Wohlfühlfilm, obwohl es Tote gibt – aber immer zur höheren Ehre der Kunst. Da tut der ehemalige Alkoholiker mit seinem Leben Buße für seinen Charakterfehler und rettet gleichzeitig eine Madonnenstatue.
Da überreicht der sterbende Schürzenjäger seinem Kameraden ein Medaillon für die Ehefrau zu Hause samt salbungsvoller letzter Worte, als wär’s eine Szene aus einem Kriegsroman der vorvorigen Jahrhundertwende. Frontpakete von den Lieben daheim, Weihnachtslieder über den knarzenden Lautsprecher im Feldlager, Kameradschaft und Todesmut – kaum eine Szene, bei der nicht knietief in die Klischeekiste gegriffen wird.
Auch einen Ehebruch gibt’s, aber der wird genau so altjüngferlich erzählt: »Wir sind in Paris, und es ist Krieg«, lässt die Kunstkennerin und Widerstandskämpferin Claire Simone (Cate Blanchett) den zögernden Familienvater James Granger (Matt Damon) wissen, ehe sie ihm, oh la la, ihr Schlafzimmer zeigt. Das erinnert nicht nur an Casablanca, sondern auch an die pubertäre Erfolgskomödie »Hangover«: »What happens in Vegas, stays in Vegas!« Danach blendet die Kamera diskret ab, ist ja »Family Entertainment«.
Und die Kunst, um die es ja eigentlich geht? Die ist selbstverständlich genau so clean, genau so Mainstream, genau so über jede Kritik erhaben. Sakrale Statuen, sepiafarbene Salonporträts, und appetitliche Tafelmalerei aus dem 19. Jahrhundert: Dafür lohnt es sich, zu leben und zu sterben. Früher war alles besser, auch die Bilder. Mit einem düsteren Otto Dix hätte man den Zuschauer möglicherweise überfordert.
Schon bemerkenswert: Während mittlerweile jede Vorabendserie ihre gebrochenen, abgründigen Charaktere braucht, strahlt ausgerechnet die Truppe um Clooney eine frischgewaschene Naivität aus. Schurken und Helden? In diesem Stück sind die Rollen ganz klar verteilt. Wenn überhaupt einer Fehler macht, dann ist es James Granger alias Matt Damon: der spricht einfach kein gutes Französisch. Sagen jedenfalls die Franzosen. Putziger Running Gag.
Ein Film als therapeutische Selbstvergewisserung eines gespaltenen und verunsicherten Landes. Im Dämmerlicht historischer Patina darf sich der amerikanische Zuschauer auf die Schulter klopfen: Er war, ist und bleibt der Good Guy auf der Weltbühne. Als hätte es weder Mỹ Lai noch Abu Ghuraib gegeben. Und das Happy End nach Showdown und Verfolgungsjagd ist so selbstverständlich wie das Amen in der Kirche.
Als kürzlich die ZDF-Serie »Unsere Mütter, unsere Väter« in einer Kinoversion in den USA anlief, hagelte es vernichtende Kritiken: Als »Fünf Stunden deutsches Selbstmitleid« verrissen die Profi-Zuschauer der New York Times die Geschichte um fünf junge Leute und ihre Erlebnisse im zweiten Weltkrieg. Das kann man so sehen. Aber zwei Stunden amerikanische Selbstbeweihräucherung sind auch nicht leichter zu ertragen. Die historischen Vorbilder der »Monuments Men« waren bemerkenswerte Männer mit einer erzählenswerten Mission. Sie hätten einen besseren Film verdient.

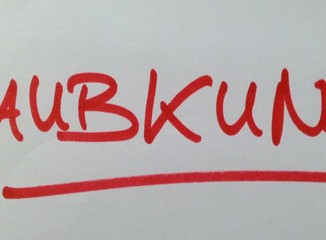
Hinterlasse jetzt einen Kommentar