

Vielleicht ist es wirklich so, dass die Bühnenkunst unter allen darstellenden Formen die vollkommenste ist, in all ihren Möglichkeiten von Distanz, Nähe und der Einbindung ihrer Geschwister Musik, Tanz und aller Bilder.
Vielleicht ist sie aber auch die Verkommenste unter ihnen, so tief wie sie sich beugen, so sehr wie sie sich verbiegen kann, in ihrer verinnerlichten Gefallsucht und dem glitzernden Ranschmeißertum, das so eng mit ihr verknüpft ist.
Auch die neue Intendantin des Deutschen Schauspielhauses in Hamburg, Karin Beier, ist diesen Gestalten ausgeliefert und, so scheint es, sie ist gewillt, zu Beginn ihrer Intendanz sich diesen komplett hinzugeben. Bei ihrem Antiken-Mammutprojekt Die Rasenden, der nächste »Marathon« – ein Begriff, dessen Geschichte ja nun mit Tod und Scheitern endet bekanntermaßen – geht es um viel.
Es geht zuallererst um die erste große Marke dieses Neuanfangs. Es geht darum, Erwartungen zu erfüllen, vor allem die, die von außen an sie herangetragen wurden nach den vielen Monaten des Siechtums und der krawalligen Hilflosigkeit an diesem Haus, das die Worte »interim« und »Lähmung« auf das Dach gepinselt hatte.
Wie stark diese Erwartungshaltung und auch der Druck auf die neue Belegschaft ist, kann man nur erahnen. Dass das die Stadt Hamburg das Originalplakat der Eröffnungsinszenierung mit einem Rahmen der Hamburg Tourismus AG versieht und in ihrer Stadtmöblierung platziert, mag zwar übliches kooperatives Marketing sein, steht aber symptomatisch dafür, was von diesem Staatstheater nun erwartet wird – Repräsentation, gar Kunst – auf jeden Fall aber öffentlich vertretbare Hochkultur.
Diese Intendantin wird es richten müssen und wird es richten, so hofft man und so erwartet man auch. Wie sehr sich da eine Art Personenkult, ja, eine Hoffnungskultur etabliert, ist in der Lokalpresse nachzulesen.
Schaut man sich gar die Kapitelunterschriften eines jüngst erschienenen Buches über Karin Beier – eine Art Unternehmerbiografie – an (»Wie Karin Beier …«), kann man froh sein, dass sie nicht auch noch die Waschmaschine oder gar das Rad erfunden haben muss.
Das alles muss die neue Theaterleiterin nicht scheren, schließlich ist sie als Theatermacherin und nicht als theatrales Pin-up in das Riesenhaus an der Kirchenallee gezogen.
Sie will arbeiten, so scheint es. Aufwändig wurde der Innenraum des Hauses über Monate umgebaut, die Zuschauer sollten näher an das Geschehen gebracht werden, ein theatrales Konzept der Nähe aufgebaut, endlich gespielt werden.
Der neu verkündete Spielplan ließ Vieles hoffen, und zudem wurde ein gewaltiges Starensemble mitgebracht, über dessen Güte nicht zu diskutieren ist, Namen wie zu des seligen Peter Zadeks Zeiten, bekannt aus Bühne, Funk und Fernsehen. Alles wartete auf den großen Start, bis zu jenem Tag, als ein verhängnisvoller Planungsfehler den Eisernen Vorhang in den Bühnenhimmel rauschen ließ und damit die komplette Dramaturgie des Neuanfangs zunichte machte. Ein Unfall, so die offizielle Verlautbarung, zugleich aber eine Katastrophe.
Nach ein paar Tagen der schockbedingten Lähmung wurde umdisponiert, wurden Alternativspielstätten gesucht, gar Inszenierungen umgeplant. Nur die große Gala sollte auf jeden Fall kommen, der Marathon, die Marke, an der sie sie messen würden, die Honoratioren der Stadt.
Jener Stadt, die sich den Star geleistet hat, um den großen weißen Kasten wieder zu dem zu machen, als was er einst geplant war, ein Bürgertheater für die Kunst. Ein Haus für das Renommée und für den Ruhm der Kultur- und Wirtschaftsmetropole Hamburg.
Karin Beier hat dem allen standgehalten, und sie hat außerordentlich klug gehandelt, das lässt sich schon jetzt sagen. Nicht nur, dass sie in der Wahl ihres Stoffes weit genug zurückgegangen ist, um die konservativen Archivare des klassisch Schönen-Wahren-Guten nicht aus der Reserve zu locken, sie hat sich auch für einen Weg entschieden, der vielen gerecht werden kann, ohne dabei zu gefällig zu werden. Das ist ein Kunststück sondergleichen und schon das verdient der Würdigung.
Denn sie hat sich für eine Art Leistungsschau, eine Messe des deutschen Subventionstheaters entschieden, fünf Dramen an einem Abend, ein jedes nach seiner Manier gehalten, ein wenig Postdramatik dort, ein bisschen Video da. Wir finden da Zitate an das Maskenspiel der Antike (»Persona«) in der allem vorausgehenden Iphigenie, ein wenig verhalten noch, statisch in der Disposition, besetzt aber mit einer lebendigen und jugendlich auftretenden Anne Müller neben dem Kinostar Maria Schrader als Klytaimnestra. Es ist ein Anfang.
Und wir sehen Karin Beiers Vision von der Verknüpfung der Künste, eine Vision vom Spielen in einer Stadt, die noch andere Szenen hat als die sich oft so hermetisch gebende Theatergesellschaft. Das in Belangen der neuen Musik so umtriebige Ensemble Resonanz hat die Aufgabe, den Fall Trojas musikszenisch umzusetzen. Es gibt eine Auftragskomposition für diesen Abend (»Eine große Stadt versank in gelbem Rauch«), die Musiker sind eingebunden ins Spiel, choreographiert und ausdrucksstark in Geste und Blick.
Es ist kurzer theatraler Moment der Vereinigung an diesem Abend, eine Aussicht darauf, dass es auf der Bühne um mehr gehen muss als um die Wiedergabe von Texten. Da mag die Komposition des Theaterkomponisten Jörg Gollasch noch so gefällig anmuten in ihrer Balance aus Dissonanz und neoklassizistischer Stilfindung, der Augenblick ist stark und erzählt dann doch mehr als jede bemüht umgesetzte Teichoskopie.
Und vielleicht sind die auf diese Schlachten-Musik folgenden Troerinnen tatsächlich ein Kernstück für die kommende Arbeit am Schauspielhaus, ist dieser Teil des Abends doch eine Übernahme der letzten Arbeit der scheidenden Kölner Intendantin Beier. In der Vergangenheit gestählt von den postdramatischen und oft statischen Schauspielarbeiten der anderen hanseatischen Großbühne, des Thalia-Theaters, mag sich der eine oder andere Hamburger doch sehr wundern, zieht denn hier ein neuer Geist des physischen Spiels, der körperlichen Entäußerung und der Grenzverletzung ein, wie man ihn dort nicht oder nur noch selten findet.
Über der Szene hängt ein großer Lautsprecher, die Schlacht ist geschlagen, die Frauen Troias, gehüllt in unförmige graue Steppdecken warten auf Erfüllung ihres Schicksals, bewacht von der beamtischen Seele der Sieger. Es ist Erde, Schmutz überall, die Gesichter sind aschfahl, man hat Angst, die sich äußert, in Wort und Körper, bis hin zur wahnsinnigen Entgrenzung, ausgedrückt in Tanz und Bewegung, Somatisierung des Elends.
Nicht ohne Grund ist hier Jean-Paul Sartres Bearbeitung des Textes gewählt worden, in seiner Reserviertheit und Zurückhaltung zeigt er vor allem die Konsequenz des vorher Geschehen, des Krieges in seiner allumfassenden Zerstörung, die bis in das Innere der Überlebenden vordringt. Für Sartre ist das vor allem Religionskritik oder zumindest der Abschied von der antiken Fremdbestimmung, die Verantwortung für das Elend liegt im Kriegsspiel der so menschenähnlichen Götter.
Das Lagerszenario, das Warten auf die Verwendung und die Auslöschung der Hinterbliebenen sind Archetypen einer Vergangenheit, die hierzulande zunehmend in den Orkus der History-Channels verschwindet. Das Theater ist an dieser Stelle der medialen Aufarbeitung himmelweit überlegen, gelingt es ihm doch, den direkten Zugriff auf Tragödie und Verantwortung zu ermöglichen.
Denn – was dann auf dieser Bühne der mit aus Köln übersiedelten Lina Beckmann als Andromache gelingt, nämlich den Zuschauer unmittelbar zu ergreifen in ihrer Entäußerung und ihrer Hingabe und was im kompletten Persönlichkeitsverlust und allertiefstem Schmerz endet, das ist unvergleichlich direkt und entbehrt jeglicher sachlichen Analyse. Die ist hier nämlich komplett fehl am Platze.
Diese spielerische Hingabe der Schauspielerin Beckmann steht exemplarisch für die Möglichkeit, Inhalte auf andere Weise als über den reinen Verstehensakt zu transportieren. So kann Theater wohl sein.
Dass sich im Portfolio auch die sogenannten experimentelleren Formen finden, raumfüllend distanzenschaffende Videoprojektionen, das larmoyante Hinausgehen aus der geschlossenen Form, die Brechung durch das ewig selbstreflexive Postdramatikum, das hingegen zeigt die nach der langen Pause folgende Orestie.
Hier wird nach den gesellschaftlichen Ursachen der großen Tragödie gegründelt, wird der Schritt zurückgegangen, den die trauernden Troerinnen zu nahe waren, die erschlaffte Gesellschaft der zu Hause gebliebenen, eine Décadence zwischen Kochshow und intellektualisierender Rollkragenbehaglichkeit. Das ist ein Zeitkommentar, eine Paraphrase auf eine auch heutige Gesellschaft der Unentschiedenen, die das zuvor gezeigte erst möglich gemacht haben. Und eine Warnung?
Dass das in einem Exkurs der hervorragenden Schauspieler Meyerhoff, Wittenborn und Wöhler über Quantenphysik als Welterklärung endet, ist dann nur konsequent. Das nächste Modell tritt an die Stelle des Entschwundenen, die Götter sind tot. Die Götter leben weiter.
Das ist keineswegs das Ende.

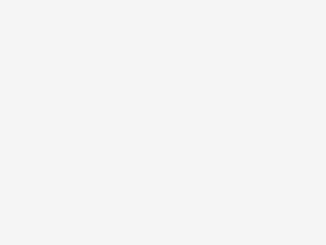

Hinterlasse jetzt einen Kommentar