Kennen sie den Doppelzeigefinger? Versuchen sie es mal. Die Unterarme parallel, die Hände leicht gegeneinander versetzt, das Gegenüber fixieren und die Zeigefinger ausstrecken. Am besten den Kopf noch leicht schräg legen und gewinnend lächeln. Kommt Ihnen das bekannt vor? Schalten Sie den Fernseher ein und schauen sie sich – nur zur Recherché – die Phalanx der »Stars« an, die dort die Sender bevölkern, nach einigen Minuten werden sie die Geste mit Sicherheit wiederfinden.
Bernd Grawert alias John Osbornes Archie Rice hat das gut studiert, die Choreographie des Entertainment beherrscht locker und souverän. Ob Doppelzeigefinger, ob Mikrophonhandling mit einfachem Finger oder den rhythmisierenden Sprachstil der Permanenz, den Unterhalter so virtuos beherrschen. Er und seine Mitspieler lavieren durch ein Labyrinth, gebildet durch marode und mannshohe Leuchtbuchstaben, die auf dem Bühnenboden liegen. Das ist ein schlichtes Symbol für die vergangene Vaudevilleherrlichkeit in der Osbornes »Entertainer« sich bewegt. Das Stück ist von 1957, in seiner Zeit als Parabel auf das untergehende Britische Empire gedeutet und ziemlich nah am Brechtschen Lehrtheater gehalten. Direktes Anspielen des Publikums, frontale Erkenntnis der Figuren, alles dabei und drin. Das hat in Einzelfiguren mittlerweile eine gewisse Penetranz, ein harter Strich an der einen oder anderen Stelle hätte zum Beispiel Franziska Hartmanns Jean ziemlich gut getan. Erklärungen zu längst Erkanntem und Gesehenen sind lästig und überflüssig. Denn genau an dieser Stelle kommt nämlich die Stärke dieser Inszenierung ans Licht – ein feines Ensemble alter und junger Thalia-Recken erspielt da den schon etwas staubigen Text, der dadurch keiner Verfremdung mehr bedarf. Die Essenz entsteht dabei im Spiel, nicht in der ausgesprochenen Deutung. Das ist wunderbar.
Christoph Bantzer ist seit 25 Jahren am Thalia, ihm genügen ein paar Sätze und zwei kleine Szenen, um ihn an diesem Abend nicht zu vergessen, auch Bernd Grawert nimmt sich sein Publikum und ist zudem ein wunderbarer Musiker, der tatsächliche Entertainer-Fähigkeiten an den Tag legt. Daß Victoria Trauttmannsdorff aber so selten auf der Thalia-Bühne zu sehen ist, das ist wirklich ein Defizit. Was diese Schauspielerin an Farben zeigen kann, ist sehens- und bewundernswert. Phoebe, die trostlosen Frau an der Seite des dauerhaft eloquenten, bramabasierenden Archie Rice, hat durch sie viele Facetten zwischen Resignation und Hoffnung, eine schöne und direkte Präsenz, die das Werk mehr als überragt.
Da die Regisseurin Christiane Pohle das Werk jetzt auf die Bühne stellt, mag die Frage erlaubt sein, warum man – neben der Möglichkeit, gute Schauspieler aus ihren Figuren heraus brillieren zu lassen – das heute überhaupt noch inszenieren muß. Die Geschichte vom Niedergang einer Unterhalterdynastie kann ja in Zeiten, wo ein Mikrophon unter schalen Gesten vorzuhalten als Orden sogenannter bildungsferner Schichten gilt, ein gewisses Interesse wecken. Auch die Verfremdungseffekte zwischen Bühnenwirklichkeit und Zuschauersitation sind in diesem Zusammenhang schöne parabolische Näherungen, aber so richtig interessant ist das alles nicht mehr und wäre es nicht so gut gelungen, ein wenig überflüssig. Aber das ist schönes Schauspielertheater. Das reicht. Viktoria!

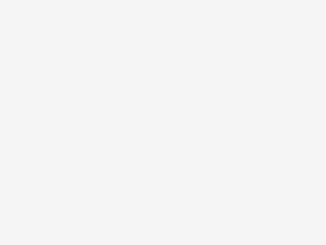
Hinterlasse jetzt einen Kommentar