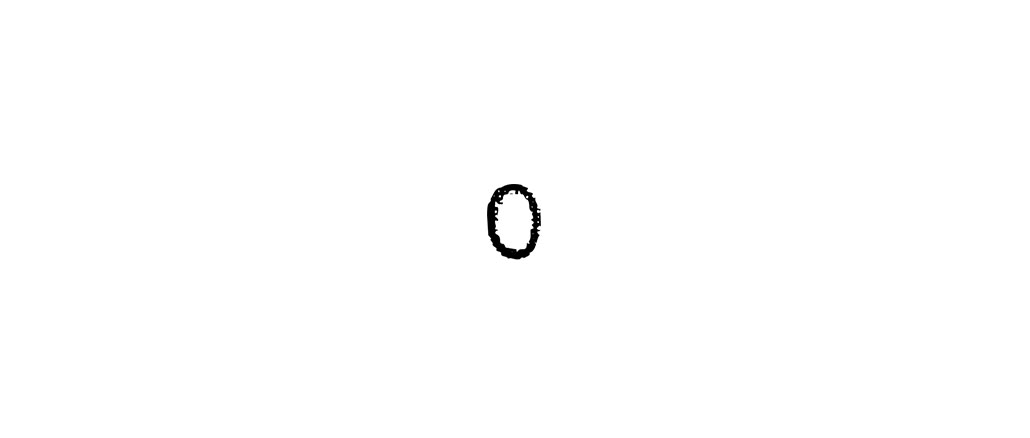
Menschen, die sich viel im Internet umtun, wissen, was »Clickbaiting« ist. Menschen, deren Verweildauer in den digitalen Medien gering ist, aber dafür gelegentlich ins Theater gehen, wissen das nicht unbedingt. Diese Form der digitalen Kommunikation ist nach einem sehr schlichten Muster gestrickt – es geht im Wesentlichen darum, mit möglichst oberflächlichen Reizen möglichst viele Menschen, vulgo »Kunden«, auf eine bestimmte Internetpräsenz zu locken, zur Vermehrung von Leserschaft, zu Gewinnung von Kunden.
Das funktioniert in der Regel über Primarreize in den Überschriften, schlichte Assoziationsreihen sollen die Neugier wecken und zum »Zugriff« verhelfen – dazu gehören Superlative genauso wie das alte Mittel »Sex and Crime«. Mitunter eröffnen solche Teaser auch mit der Einleitung: »Kaum zu glauben …«. Einfach gesagt – es ist vor allem eine Kommunikation des ersten Einfalls, denn das naheliegendste führt dort zum Erfolg, ist die Neugier geweckt, ist der Kunde gefangen.
Nach diesem Prinzip funktioniert auch Jette Steckels Theater-Adaption der »10 Gebote«. Das ist in der Tat »kaum zu glauben« – denn die Inszenierung des Deutschen Theaters in Berlin ist zu den Hamburger Lessingtagen geladen, dem Festival, das sich den Namen des Theologen und Aufklärers Gotthold Ephraim Lessing gegeben hat und sich im Jahr des Reformationsjubiläums programmatisch an die allgemeinen Feierlichkeiten angedockt hat. Festivalleiter Joachim Lux formuliert seine hohen Ansprüche so: »Selbst aus dem Ritus entstanden ist das Theater immer wieder beides: der Versuch der Rekonstruktion von Sinn, wie aber auch blasphemische Attacke auf Bigotterien jedweder Art. Nach diesem Programm gehen Sie, verehrtes Publikum, sicher gut vorbereitet in das große Lutherjahr mit all seinen Lutherspielen und können auf eine Luther-Playmobilfigur, ja die gibt’s wirklich, sicher gut verzichten …«
Dennoch – der Impuls des ersten Augenblicks, des Einfalls, der Primarassoziation ist das beherrschende Moment dieses Abends. Steckel und ihr Team haben zu jedem Abschnitt des Dekalogs einen anderen Autor aufgeboten. Diese Texte sind nicht unbedingt für das Theater geschrieben, bis auf eine Auftragsarbeit von Mark Terkessides sind sie nicht einmal Thementexte zu den einzelnen Fragestellungen dieses überlieferten Regelwerkes, das ja nicht allein Äußerung von Religiosität ist, sondern Basis für eine gesellschaftliches Miteinander. Die Bühnenbearbeitungen dieser Regeln sind hier vor allem Assoziationen zu den Themenbereichen des Dekalogs und schon mit diesen beginnt die Banalität, oder besser gesagt, die Hilflosigkeit im Umgang mit ihnen. Wie das funktioniert, lässt sich am deutlichsten anhand des fünften Gebotes sehen, das eines der stärksten Tabus unserer Gesellschaft beschreibt: »Du sollst nicht töten.«
Die Assoziationsreihe ist, wie gesagt, simpel. In einer großflächigen Projektion werden drei Interviewszenen gezeigt, man sieht die Interviewten im Gegenlicht, ihre Gesichter sind nicht zu erkennen. Sie sprechen über ihren sexuellen Fetisch, die Vorstellung, gegessen zu werden, Kannibalismus also. Diese Interviews sind nachgestellt, offenbar nach »Originalprotokollen«, wirken trotzdem mitunter unfreiwillig komisch, so bizarr sind die Phantasien und so distanziert ist die abgefilmte Reproduktion.
Die erste Assoziation zum 5. Gebot ist also die am stärksten erscheinende Tabuverletzung, der Kannibalismus. Im Laufe des dritten Interviews erscheint unterhalb der Projektionsfläche ein katholischer Priester im Messgewand, er teilt die Hostie aus. Das ist offenbar der zweite Assoziationsschritt der Jette Steckel: Eucharistie – Kannibalismus. Denn in den Einsetzungsworten zum Abendmahl wird ja gesagt: »Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird.«
Diese intellektuelle Schlichtheit ignoriert zwar die über Jahrhunderte betriebene Auseinandersetzung über den Begriff der Wandlung, über symbolhafte Handlungen, die Übertragungs- und Deutingsproblematik des Begriffes »Leib«, das scheint aber nicht zu stören. Denn es funktioniert wie im Netz: Tötungsverbot, Kannibalismus, Abendmahl. Genau das ist theatralisches »Clickbaiting«, der größtmögliche Reiz ohne jegliche Vertiefung des Themas.
Von ähnlichem Kaliber sind die meisten der zehn Dramolette dieses Abends, der sich insgesamt über fast vier Stunden hinzieht. Dabei ist die Qualität der ausgesuchten Texte höchst unterschiedlich, von der Schlichtheitsheitprosa Sherko Fatahs aus den Tiefen des deutschen Fernsehkriminalalltags (»2. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen«) bis hin zur wohlfeilen Suada der Dramatikerin Felicia Zeller zur sogenannten »Lügenpresse« (»8. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden …«), chorisch vorgetragen von einer Horde beturbanter Mosesfiguren, die die Gesetzestafeln behämmern: Lüge – Lügenpresse – Moses. In dem von Mark Terkessides für den Abend geschaffene Text zu »Du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus.« raschelt das Papier der Theorie so laut, dass die Regie das Ganze in eine grellbunte Disko-Verpackung hüllen muss, inklusive B52’s‑Zitat (»Love Shack«) aus den späten 80er Jahren, denn es geht um Verteilungsdebatten, wie sie jeder WG der »Marxistischen Gruppe« in dieser Zeit gut zu Gesicht gestanden hätten.
Literarisch auffallend stärker sind Nino Haratischwilis Schilderung einer Verführung (»Die Nacht aus Papier« zu »6. Du sollst nicht ehebrechen.«) und vor allem Jochen Schmidts warmherzige Erinnerungen an die Vorgeneration (»4. Du sollst Vater und Mutter ehren.«). Theatralisch passiert da zwar nicht viel, aus dem einen wird eine rotlichtige Nachtclubnummer im Parkett mit Getränkeausschank an das Publikum, aus dem anderen eine der bekannten Familienfeiertafelgesellschaften. Und, um bei den ersten Einfällen zu bleiben: In der Regel wird der Wortlaut des jeweiligen Gebotes und der jeweilige Autor mit Kreide auf die Bühnenkonstruktion geschrieben, damit man auch ja nicht durcheinanderkommt. Bei Vater und Mutter schreibt man in der 1941 aus den Lehrplänen verbannten Sütterlin-Schrift. Eltern – Historie – Sütterlin. Wahrscheinlich auch noch »Nazi«. Clickclick.
Aber wenn die komplexe Frage nach der Existenz Gottes, der Selbstdefinition und der Behauptung seiner selbst, das so schwierige »Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir.« des 1. Gebotes gestellt wird, dann tut man sich äußerst schwer mit einer Umsetzung. Heraus kommt ein »wilder« Text vom Clemens Meyer, dargeboten von einer Kinderfigur im Comic-Strampelanzug, dessen tiefste Durchdringung aus einem Zitat aus dem Fantasy-Epos »Highlander« besteht: »Es kann nur einen geben«.
Als dann am Schluss eine merkwürdige Fellkreatur mit einem lebenden Schaf (Achtung, Primarassoziation: »Der gute Hirte«) an der Leine auf die Bühne tritt und sich mit einem dieser herzzerreißenden Songtexten, wie sie in Deutschland wohl nur ein Rocko Schamoni schreiben kann, für seine Schöpfungsunfälle entschuldigt, dann ist man erschöpft geneigt, der Regisseurin diesen ganzen Simplizitäts-Mist zu verzeihen. Man kann ihr nicht ihren möglicherweise vorhandenen Atheismus oder den Zweifel vorwerfen, denn nicht einmal der spielt hier eine Rolle. Es unterhält das Ganze auf irgendeine Art und Weise, aber es ist durch und durch »Einfallstheater«. Was aber zählt, ist: Ganz offenbar hat sie nie gelernt, sich komplexer mit Themen auseinanderzusetzen als in der Form, die sie hier zeigt.
Aber – wenn so eine Inszenierung die Antwort des Theaters auf die Fragen und Stellungnahme zu den gesellschaftlichen Themen dieser Zeit sein soll, dann macht es sich als reflektierende Kunstform obsolet. Es ist eine Beleidung für den Intellekt vieler Zuschauer und zugleich ein Armutszeugnis für die Kunstform Theater. Hier ist es komplett bedeutungslos geworden, weil es keine Bedeutungen mehr sucht, sondern bereits vorgefertigten Deutungsmustern hinterherläuft, vor allem dem Vorurteil. Man erinnere sich an die Einsetzungsworte des Intendanten zum Festival, zu dem diese Inszenierung eingeladen wurde: »… der Versuch der Rekonstruktion von Sinn«. Das wiegt schwer.



Hinterlasse jetzt einen Kommentar