
Auf der meterhohen, schroffen Schräge liegt ein toter Schimmel, und der Wind pfeift. Unheilvoll hängen die kommenden Geschehnisse fast greifbar in der Luft, drohend schweigt die Glocke, die bei einer Springflut geläutet wird. Das Ensemble nimmt Aufstellung oben an der kantigen Version des Deichs, die in den gesamten Bühnenraum hineingebaut ist und dem Publikum auf den seitlichen Plätzen leider den Blick auf einige Szenen verwehrt (Bühnenbild Bettina Pommer).
„Herr, du mein Gott, sei gnädig mit uns Menschen!“ – wir befinden uns im Jahr 1756, kurz vor der drohenden Sturmflut, die der Dorfgemeinschaft bevorsteht. Siebenmal werden die Schauspieler an diesem Abend diese Aufstellung in nur leichten Variationen einnehmen und die Zuschauer teichoskopisch das Grauen miterleben lassen, als die allmächtige Sturmflut heranrollt. Mit jeder Erzählung wird etwas mehr offengelegt über die Schuld eines jeden in der unheilvollen Nacht, die den Deich zum Einbruch bringt. Die düstere Novelle Theodor Storms über den Kleinknecht Hauke Haien, der zum Deichgrafen aufsteigt und sich Gott und den Naturgewalten mit der Macht der Mathematik entgegenzustemmen versucht, wird in dieser Szene in ihrer ganzen Wucht greifbar.
Die dunklen Tage beginnen mit einem Spiel. Das Eisboßeln beim Deichgrafen gewinnt ausgerechnet der junge Knecht Hauke Haien – und gleichzeitig das Herz der Grafentochter Elke. Ein Kleinknecht hat auf einer Veranstaltung beim Deichgrafen nur am Rande etwas zu suchen – und schon gar nicht das Spiel zu gewinnen. Neid und Missgunst sind ihm gewiss – weit bevor er durch die Ehe mit der Deichgrafentochter Elke die höchste Position des Dorfes einnimmt. Es ist eine Szene, die vorwegnimmt, dass die Dorfbevölkerung keine Veränderung duldet.
Simons lässt seine Schauspieler nicht agieren, nur erzählen. Selbst zu Beginn der Liebesgeschichte zwischen Hauke und Elke findet nichts als Sprödheit statt, keine Berührung, kein Blick. Es ist eine schroffe und karge Welt, in der kein Platz ist für Zwischenmenschliches, und dergestalt kühl und unnahbar ist auch die Interaktion zwischen den Schauspielern. Jens Harzer und Birte Schnöink als Deichgrafen-Ehepaar werden noch einige Zwiegespräche führen, sich aber fast nie berühren. Die Frau, die bei den hochgreifenden Theorien ihres Mannes gedanklich meist mühelos mithält, wird ihm auch bei der Planung des neuen Deichs mehr Partner als Gattin sein. In diesen Szenen darf echter Dialog stattfinden – Momente, bei denen man fast aufatmen möchte, weil sie einen kurz aus der Trockenheit des ständigen Nach-Vorn-Spielens reißen, die Simons seinen Schauspielern verordnet hat.
Das Ensemble in durchweg schwarzen, an Friesenmaler Carl Ludwig Jessen erinnernden Kostümen (Teresa Vergho), hat es an diesem Abend nicht leicht. Bei der fünften Wiederholung der Springflut-Schilderung werden im Publikum erste Lacher laut. Das strenge Korsett, in das Simons seine Inszenierung schnürt, verlangt Sitzfleisch und Konzentration. Seine hervorragenden Schauspieler – beeindruckend vor allem Kristof van Boven in seiner Körperlichkeit als Kind Haukes – sind klar geführt und haben doch kein leichtes Spiel. Nach der Pause bleiben viele Sitze im Parkett leer, der Abend kann durchaus ermüden. Und doch gibt es diese Momente, wo man den Atem anhält, weil die Inszenierung so greifbar die Rückwärtsgewandtheit, Gottesfürchtigkeit und Düsternis dieser kleinen Gemeinschaft am Meer greifbar macht. Augenblicke, in denen man das drohende Unheil fast anfassen kann, das da täglich über den Menschen hängt. In dieser Atmosphäre wird eine Gesellschaft greifbar, die zugrunde geht in ihrem unbeirrbaren Glauben, der hier nicht ohne Aberglauben möglich ist. Einer, der sich auf Euklid, die Mathematik, seinen Geist, kurz: auf die Aufklärung verlässt, wird hier unweigerlich scheitern.
Jens Harzer spielt Hauke Haien als einen Hadernden, einen, der seiner Zeit voraus ist, unbeirrbar gegen die Widerstände anrennt, ohne zu rennen. Die Herausforderungen, die das Leben an der Küste an ihn stellt – vom Widerstand der Dorfbevölkerung bis hin zur Geburt des zurückgebliebenen Kindes – erträgt er stoisch, geleitet von der Idee, etwas Größeres zu schaffen. Einzig, als Elke im Kindbett zu sterben droht, darf Verzweiflung durchschimmern. Harzers Spiel ist wie meist reduziert, geprägt von seiner unnachahmlichen Art, die Sätze zu zerdehnen und teilweise gegen ihren Sinn zu bürsten. Als zum siebten Mal die Springflut heranrollt und er ihr sich auf seinem verfluchten Schimmel entgegenwirft, ist er allein auf der Bühne, allein mit all den Fragen ohne Antwort. Der Deich bäumt sich senkrecht zu voller Höhe auf, Harzer entkleidet sich und steht am Ende nackt bei harten Gitarrenriffs im Gegenlicht. Und scheint schließlich doch erlöst: „So hat man endlich Ruhe vor den Menschen.“
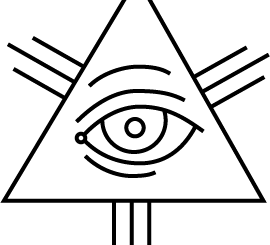


Hinterlasse jetzt einen Kommentar